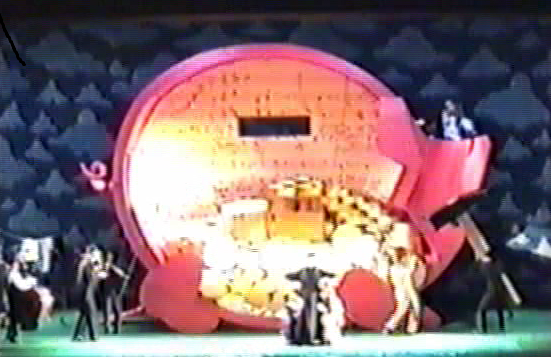Suor Angelica Opera lirica in un atto Gianni Schicchi Opera comica in un atto Libretti: Giovacchino Forzano
- Produktion |
- Besetzung |
- Fotos |
- Video
La Traviata Melodramma in tre atti Libretto: Francesco Maria Piave nach Alexandre Dumas fils
Das Traumfresserchen Ein Singspiel in 7 Bildern und 6 Zwischenspielen Text von Michael Ende Aufführung anläßlich des 70. Geburtstages von W. Hiller
»Ein Triumph traumhafter Bilder inszeniert von Axel Kresin.
Unbedingt hören und sehen!«

L' Italiana in Algeri Dramma giocoso in due atti Libretto: Angelo Anelli nach einer Inszenierung von Jean Pierre Ponnelle
»Es ist wieder spannend, in die Kölner Oper zu gehen.
Das war ein unglaubliches Bravo-Rufen.«
Der zerbrochene Krug Oper mit Vorspiel in einem Akt nach Heinrich von Kleist Der Diktator Tragische Oper in einem Akt (zwei Bildern), Text von Ernst Krenek
Le pauvre matelot Complainte en trois actes, Text von Jean Cocteau Larmes de couteau Opéra en une acte, Text von Georges Ribemont-Dessaignes Deutsche Erstaufführung in Originalsprache L'abandon d'Ariane Opéra-minute en cinq scènes, Text von Henri Etienne Hoppenot
»Mitreißender und abenteuerlicher kann Theater nicht sein.
Wagnerscher Ovationsjubel.«
Il mondo della luna Dramma giocoso in tre atti Libretto: Carlo Goldoni
Il barbiere di Siviglia Commedia in due atti Libretto: Cesare Sterbini nach Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais

Finissage zum 60.Geburtstag Lesung mit szenisch-musikalischen Einlagen nach einer Idee von Axel Kresin
La fede ne' tradimenti Melodramma in tre atti Libretto: Girolamo Gigli anläßlich der 300.Wiederkehr der Krönung des ersten Königs in Preußen
»Ariostis Barockoper hatte in der ehemaligen Freien Volksbühne in Berlin
umjubelte Premiere.«
La vera costanza Dramma giocoso in tre atti Libretto: Francesco Puttini
Jakob Lenz Kammeroper Text von Michael Fröhling frei nach Georg Büchner
Die letzte Tiefe des Nichts
Das künstlerische Interesse an der Person Jakob Michael Reinhold Lenz ist in den 70er Jahren eng mit Büchners Erzählung verknüpft und ist zuweilen mehr eine Büchner-, als eine Lenz-Rezeption. Büchners Erzählung war ein literarischer Modestoff der 68-Generation. Als ein Wegbereiter dieser Modeströmung gilt Michel Focault, der 1961 die Histoire de la folie à l'âge classique und 1975 Surveiller et punir. La naissance de la prison publizierte und darin darstellte, daß bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts die Wahnsinnigen in Irrenanstalten als ungeheure Monstren zur Schau gestellt wurden. Interessanterweise erschien die deutsche Erstausgabe von Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses im Suhrkamp-Verlag, im Jahre 1977. Rihms eigentlicher Kompositionsprozess vollzog sich von Dezember 1977 bis Juni 1978.

Nach Abschluß der Komposition, veröffentlicht Rihm im Januar 1979, also zwei Monate vor der Uraufführung die Chiffren von Verstörung. Anmerkungen zu >Jakob Lenz<, mit denen er einen Einblick in seine Denk- und Vorgehensweise beim kompositorischen Prozeß zur Kammeroper Nr.2 Jakob Lenz gewähren möchte:
„Büchners Lenz ist eine Zustandsbeschreibung innerhalb eines Zerfallsprozeßes. Momente einer bereits vollzogenen - aber noch nicht akzeptierten - Verstörung. Diese wird evident an den Berührungspunkten zur Umwelt. Und diese Berührungspunkte wiederum sind es, die Michael Fröhling versuchte szenisch nachzustellen. Lenz ist immer gleich verstört; nur die Nähe der Umwelt zu dieser Verstörung wächst oder schwindet. [-] Der kompositorische Prozeß war identisch mit dem stufenweisen Verstehen einer Existenz wie der von Jakob Lenz. Die historische Figur trat, je genauer sie datisch und atmosphärisch in meinem Intellekt anwesend war, aber zurück zugunsten einer Chiffre von Verstörung, als die ich Lenz dann begriff. [-] Von da aus erklären sich die Versuche, ihm zu nahen - eingeschlossen: mein Versuch, ihn durch musikalische Darstellung zu interpretieren -, als gescheitert, weil Lenz [-] selbst bereits in einem festgefahrenen Zustand der vollzogenen Verstörung verharrt“.
Ist Lenz wirklich immer gleich verstört, wie Rihm dies beschrieben hat? Schon Ivanka Stoianova hat darauf hingewiesen, daß „das Insistieren mancher rhythmischer und harmonischer Konstellationen der greifbare Ausdruck für die immer wieder eintretende Starre der außerordentlichen Hauptfigur ist“. Starre tritt ein und Starre löst sich. Ist Lenz wirklich immer gleich verstört? Warum sieht Rihm seinen Versuch als gescheitert an?
Rihms Lenz - über die Bilderfolge hinweg betrachtet - schreit auf, flüstert lautlos, glaubt, wandert, predigt, kämpft diskutierend, dichtet, liebt, leidet, verliert den Glauben, verliert den Verstand, will sich töten, zieht es aber vor zu Verstummen. Es bietet sich daher förmlich an die Bilderfolge der Kammeroper Nr.2 als Lenzens Lebensabschnitte zu begreifen. Bereits 1937 hatte Karl Vietor die immer wieder geltend gemachte These vom nihilistischen Büchner aufgestellt; daß das Schicksal des Dichters Lenz, der in der historischen Realität schließlich in Moskau verkam, „die Tiefe, die letzte Tiefe des Nichts, zu der Büchners Helden alle hinabstürzen“ repräsentiere.
Handelt es sich bei Rihms Aussage zu seinem Scheitern beim Versuch Lenz zu nahen, um ein tatsächliches Gefühl bezüglich eines gescheiterten Versuches, Lenz durch musikalische Darstellung in einer ganz bestimmten, bewussten Art und Weise zu interpretieren? Wenn es wirklich nur bei einem Versuch geblieben wäre, wie könnte diese andere Art und Weise des „unfreiwilligen“ Ergebnisses seines Kompositionsprozesses interpretiert werden? Ein Interpretationsansatz steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem folgenden Hinweis von Sigrid Damm:
„August Wilhelm Hupel ist insofern von großem Interesse, da er als livländischer Aufklärungsschriftsteller den stärksten sozialen Gestus hat, sich nicht nur mit Topographie und Landeskunde, Gerichtsbarkeit und Geschichte sondern auch mit der Lage der Ärmsten befaßt, mit der der Soldaten vor allem. Das tut er unter einem sehr merkwürdig erscheinenden Aspekt. Er sieht in der Sexualität eine dem Menschen, vor allem dem zur Enthaltsamkeit gezwungenen Soldaten auferlegte Qual, eine Versklavung. Als Lösung schlägt er die Kastration vor, plädiert aber gleichzeitig für die Heirat. >Vom Zweck der Ehen oder dem Versuch, die Heirat von Kastraten zu verteidigen< heißt eine Publikation, eine andere >Origenes oder die Verschneidung<. Diese widersinnigen Vorschläge erwachsen aus der Unmenschlichkeit und Unnatur der gesellschaftlichen Verhältnisse im damaligen Livland. Der junge Lenz wird mit diesen Auffassungen konfrontiert worden sein, als ernsthafte Vorschläge ernsthafter Menschen erlebt er sie.“
Durch den maßgeblichen Auftritt der Kinder im - aufgrund des Glaubensverlustes von Jakob Lenz: „Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ - zentralen 10. Bild der Oper bietet es sich förmlich an, die Auftritte der Kinder, deren Funktion in der Sekundärliteratur kaum beachtet wurde, als Sinnbild dessen auszubauen, daß Lenz aufgrund seiner sozialen Stellung niemals eine Familie hätte gründen können? Im Gegensatz zu Goethe hätte er niemals ernstlich um die Hand von Friederike (Elisabeth Brion) anhalten können. Die ablehnende Haltung ihres Vaters, des Landpfarrers Brion, und dessen Besuche bei Jakob Lenz in der Militärfestung Fort Louis zeugen als Indiz dafür. Eine Umkehr für Lenz zu diesem Zeitpunkt erscheint in der Oper noch möglich.
Ist es szenisch realisierbar, die Kinder in Rihms Oper als Synonym für die absolute Unfähigkeit Lenzens, jemals eine Familie gründen zu können, durch dieses Werk zu führen. Als Sinnbild einer inneren, niemals erfüllten Sehnsucht, gekoppelt mit dem äußeren Zwang sich dieser ein Leben lang aussetzen zu müssen.
Neben den Gesangsauftritten der Kinder in der Predigt (5.Bild) und im von mir sog. Himmelsbild (10.Bild) lassen sich anhand der Partitur acht weitere Abschnitte, die markant hörbar sind, erkennen, in denen eine dramatische Zuspitzung durch Lenzens Konfrontation mit den Kindern als sinnvoll erscheint. In meiner szenischen Lösung erscheinen die Kinder äußerlich engelsgleich und innerlich eiskalt. Im Folgenden werden diese Auftritte zum besseren Verständnis im Hinblick auf die Stringenz der Szene, wenn auch nur skizzenhaft dargestellt. Maßgebend für die Auswahl dieser Passagen war in der Regel die Klangfarbe bei den Auftritten und Abgängen der Kinder. Diese Klangfarbe, die in allen folgenden Abschnitten enthalten ist, setzt sich im Wesentlichen aus drei Klang-Elementen zusammen: 1) das Geräuschhafte, z.B. werden die Celli >sul ponticello< (auf drei Saiten gleichzeitig) im >fortefortissimo< geschlagen und dabei mit Tomtoms im Schlagzeug kombiniert; 2) das Echohafte, z.B. wiederholen die Celli zunächst den Hauptklang (vom Beginn des Werkes) in Originallage, bevor sie von normaler Spielweise zum >Flageolett< wechseln und 3) der Einsatz des Ambosses.
1. Abschnitt (Partiturseite 43 f., Takt 67-92)
Der in der Partitur vorgeschriebene Abgang der Kinder wird verzögert. Zwischenzeitlich
abgegangen, tauchen die Kinder in den ersten vier Takten unmittelbar im Gebirge auf und
bewegen sich anschließend langsam auf Lenz zu, der nach seiner Predigt am Brunnen
versunken in sein Spiegelbild zusammengesackt war. Der Knabe hebt eine Waschschüssel
auf, das Mädchen tippt Lenz mit dem Einsatz der Baßklarinette auf die Schulter,
woraufhin sich dieser zu ihr umwendet. Mit eiskalter Miene weist ihm das Engelsgeschöpf
mit dem Einsatz der Oboe und des Englisch-Horns den Blick in die vom Knaben gehaltene
Waschschüssel zu werfen, in der Lenz sich erneut selbst reflektiert. Der Knabe reicht
Lenz mit dem Einsatz der Trompete und der Posaune die Hand, woraufhin sich dieser zögernd
erhebt und vom Knaben geführt, gefolgt vom Mädchen, mit dem Einsatz der Baßklarinette
im Gebirge verschwindet.
2.Abschnitt (Partiturseite 63 f., Takt 113-136)
In den ersten drei Takten blicken die Kinder am höchsten Punkt des Gebirges hinter
einer symbolisch angedeuteten Sonne - eigentlich ein Heuballen der Landarbeiter - hervor und
verstecken sich anschließend erneut, bevor sie mit dem Herabrollen selbiger beginnen
und damit den Beginn der geistigen Umnachtung Lenzens einläuten. Am Ende sind sie
erneut hinter dem Gebirge verschwunden.
3.Abschnitt (Partiturseite 80-82, Takt 148-164 und 1-4)
Mit Beginn des Abschnitts steigen die Kinder zum höchsten Punkt des Gebirges auf, um
dort zum Gesang einzusetzen. Dabei bilden sie den höchsten Punkt in der szenisch
aufgebauten Achse Kinder-Friederike-Lenz. Mit dem Einsatz des Cembalos reißt Lenz die
Tür der Hütte auf und sackt zu Boden. Während dieses Traumbildes - im
Sologesang der Kinder, in dem Rihm aus Schumanns Kinderszenen op. 15, Nr. 12 zitiert -
erscheint Lenz als Spiegelung seiner Selbst leibhaftig Friederike (die verkleidete 1.
Stimme) im Fenster der Hütte, wodurch für ihn der Eindruck entsteht, als würde
Friederike selbst zu ihm singen. Für den Zuschauer scheinen dahingegen die Kinder
„die Fäden in der Hand zu halten“, bevor diese wieder langsam im Gebirge
abtauchen, nachdem die Durchleuchtung des Fensters (das nun wieder als Spiegel erscheint)
abrupt beendet worden war.
Nachdem die Kinder im 10. Bild mit der Öffnung des Fensters symbolisch das (Fenster-) Kreuz zerstört und damit den Einsatz des Amboß’ ausgelöst haben, geben sie Lenz die Worte bis zu seinem Glaubensverlust vor. Am Ende des Bildes wird es schlagartig dunkel.
4. Abschnitt (Partiturseite 103 f., Takt 29-43)
Lenz (nur noch mit Unterhose bekleidet) ist wie der „Erlöser am Kreuz“ am Hüttenpfosten
zusammengesunken. Die Kinder tauchen langsam mit dem Einsatz der Bläser im geöffneten
Fenster auf und treten mit Einsatz des Schlagwerkes hinter der Hütte, einen
Nebelschwall mit sich ziehend hervor, wobei sie Lenzens Zwangsjacke (eigentlich ein
Stimmenkostüm) wie ein Leichentuch bis zu der Stelle vor sich hertragen, an der Lenz später
die Zwangsjacke freiwillig aufgreifen und anziehen wird .
5. Abschnitt (Partiturseite 138 f., Letztes Bild ,Takt 2-8)
Lenz ist völlig verzweifelt, weil Oberlin und Kaufmann die Hieroglyphen - Lenz selbst
hatte das Wort „Nacht“ in einer vorhergehenden Szene auf den Fels geschrieben -
nicht wahrnehmen können. Unbemerkt von Oberlin und Kaufmann tauchen die Kinder erneut
im Gebirge (an derselben Stelle wie im 1. Abschnitt) auf und beginnen mit dem Einsatz des
Amboß’Lenz durch Streicheln so zu beruhigen, daß dieser einschläft,
bevor die Kinder langsam wieder mit dem Einsatz der Bläser im Gebirge abtauchen.
6. Abschnitt (Partiturseite 142 f., Takt 30/31 und 35/36)
Die Kinder gucken mit dem Einsatz der Bläser hinter dem Gebirge hervor und treten
unbemerkt von Oberlin und Kaufmann hinter das geöffnete Fenster der Hütte, bevor
sie Lenz in der Generalpause zischend mit dem Zeige-Finger auf den Lippen andeuten, daß
er zu schweigen habe. Lenz kann nun nur noch das Wort „konsequent“
hervorbringen.
7. Abschnitt (Partiturseite 148 f., Takt 64-66)
Die Kinder schließen die 4. Wand, der viel zu kleinen Hütte, in die Lenz von
Kaufmann hineingestoßen wurde, mit einer vorerst noch durchsichtigen Spiegelwand.
8. Abschnitt (Partiturseite 150 f., Takt 80-86)
Lenz verschwindet (im Stimmenkostüm) als ein Teil seines Selbst im Spiegel - dabei das
Wort „konsequent“ rufend - bevor er abschließend aus eigenem Antrieb
verstummt.
© Axel Kresin
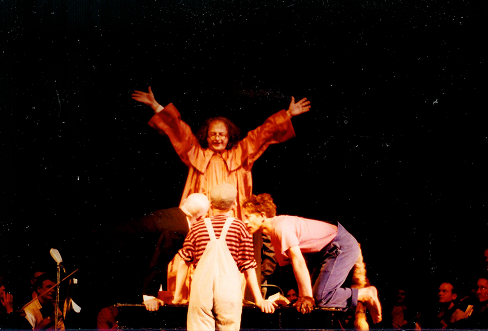
Peter gegen den Wolf Eine musikalische Erzählung für Kinder Bearbeitung von Justin Locke Europäische Erstaufführung
»Mit einfachen Mittel zaubert die Inszenierung eine Märchenwelt auf die Bühne.«